
„Wir brauchen Mut, um die Herausforderungen anzunehmen!“
27. Dezember 2017
DIVSI-Schirmherr Joachim Gauck über digitale Kommunikation, Vertrauen, Sicherheit und den Schutz des Persönlichkeitsrechts. Um „Digitale Kommunikation – auf der Suche nach Vertrauen und Sicherheit“ ging es bei einer hochrangig besetzten Info-Veranstaltung, zu der DIVSI nach Berlin eingeladen hatte. Basis war die Präsentation des Projektberichts über Vertrauen im digitalen Zeitalter, erstellt vom iRightsLab im Auftrag vom […]
Blogbeitrag anschauen

Von Cloud-Computing bis Social Media: Datenschutz im digitalen Zeitalter
8. Dezember 2017
Von Jenna Eatough Unsere heutige Zeit ist geprägt von einer unablässigen Erreichbarkeit: Die Digitalisierung und die damit einhergehenden technischen Errungenschaften scheinen uns fest im Griff zu haben. Ein Leben ohne Smartphone und Tablet – für viele undenkbar. Uns wird ermöglicht, verschiedenste Inhalte im Nullkommanichts über die immaterielle Datenautobahn in die Welt hinauszutragen. Von dieser neuartigen […]
Blogbeitrag anschauen

Digitale Grundrechte und Internet Governance
26. November 2017
Wie sind freie Meinungsäußerung und Datenschutz in unserem Zeitalter zu praktizieren? Von Wolfgang Kleinwächter Seit seiner Erfindung galt das Internet als ein Wegbereiter der Demokratie. Das Internet ermöglicht, wovon die UN-Menschenrechtsdeklaration 1948 träumte. In Artikel 19 wird dort nicht nur das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung fixiert, es wird auch hinzugefügt, dass dieses Recht „unabhängig von […]
Blogbeitrag anschauen

Mehr staatliches Engagement für Sicherheit im Internet gefordert
20. November 2017
Klare Aussagen zu den Wünschen der Nutzer. Erkenntnisse der neuen DIVSI-Studie in Berlin vorgestellt. Thema auch Online-Postfächer. Von Michael Schneider Auf reges Interesse ist die jüngste DIVSI-Studie „Digitalisierung – Deutsche fordern mehr Sicherheit“ gestoßen, die in Berlin vorgestellt wurde. Schwerpunkte der Untersuchung waren die Einstellungen der in Deutschland lebenden Menschen zur Digitalisierung und die Meinung […]
Blogbeitrag anschauen

„Digital Leadership“ revisited
14. November 2017
Digitalisierung in Unternehmen ist zur Chefsache geworden. Von Markus Klimmer Im November 2016 wurde das Buch „Digital Leadership – Wie Deutschlands Top-Manager den Wandel gestalten“ veröffentlicht. Grundlage waren Interviews mit 31 Vorstandsvorsitzenden aus Wirtschaft, öffentlichen Organisationen und Gewerkschaften. Seitdem hat sich in der Einstellung der CEOs und der Situation einiges geändert, wie aktuelle Interviews zeigen. […]
Blogbeitrag anschauen

Paradoxien im Sicherheitsempfinden
25. August 2017
Deutsche fordern mehr Sicherheit im Internet – das ist das Ergebnis unserer jüngsten Studie, die das DIVSI zusammen mit dimap durchgeführt hat. Besonders auffällig ist, dass die Ergebnisse von auffallenden Paradoxien gekennzeichnet sind – insbesondere in Hinblick auf die Möglichkeiten der Einflussnahme durch Internetnutzer. Die Studie zeigt, dass sich Internetnutzer mit dem Thema Sicherheit im […]
Blogbeitrag anschauen

Digitalisierung: Herausforderung und Chance für alle
27. Juli 2017
Carola Veit, Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft: Theoretisch kommuniziert „jeder mit jedem“ – und damit leider auch „jeder gegen jeden“. Berichte von Afia Asafu-Adjei Carola Veit, Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, dankte in ihrem Grußwort zur Eröffnung des Forums dafür, dass mit der Thematik „Ohne digitale Teilhabe keine soziale Teilhabe – Ist das Smartphone unser Tor zur […]
Blogbeitrag anschauen

Wählen gehen. Gibt es dafür auch schon eine App?
14. Juli 2017
Wie die Administration von den Erfahrungen der Wirtschaft profitieren könnte. Aleksandra Sowa Kenneth Arrows Satz der Sozialwahltheorie – auch Arrow-Paradoxon genannt – ist das, was man auch als Killer-App für das wichtigste demokratische Verfahren, die Wahlen, bezeichnen könnte. Das Theorem, das von Arrow in seiner Dissertation „Social Choice and Individual Values“ im Jahr 1951 veröffentlicht […]
Blogbeitrag anschauen

Datenschutz im Wahlkampf
10. Juli 2017
Einfache Grundregeln helfen Politik und Bürgern gleichermaßen. Frederick Richter Noch wissen wir nicht, welches Thema im Bundestagswahlkampf die Agenda bestimmen wird. Eine große Überraschung wäre es allerdings, würden sich Bundeskanzlerin Merkel und ihr Herausforderer Martin Schulz heftige Debatten gerade um das Thema Datenschutz und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung liefern. Für diesen Bereich muss daher […]
Blogbeitrag anschauen

Mit dem Alter ins Gerede gekommen
3. Juli 2017
Wohin steuert die E-Mail? Unternehmen und Behörden versuchen immer öfter, sie gezielt für sich zu nutzen. Zwei DIVSI-Umfragen zeigen: Die Bevölkerung ist skeptisch. Von Meike Otternberg Es war der 3. August 1984, 10:14 Uhr MEZ. Michael Rotert von der Universität Karlsruhe empfing unter seiner Adresse „rotert@germany“ die erste E-Mail in Deutschland – eine Grußbotschaft von […]
Blogbeitrag anschauen

Hatespeech – die große Herausforderung
3. Mai 2017
Kann unsere Gesellschaft es zulassen, wenn Meinungs- und Funktionsträger eingeschüchtert und bedroht werden? Von Simon Assion Hatespeech“, das ist eigentlich nichts wirklich Neues. Schon immer haben Menschen gehasst, und schon immer haben Menschen diesen Hass auch ausgesprochen. Und doch geht es bei der Debatte um „Hatespeech“ um etwas, das sich in unserer Gesellschaft gerade ganz […]
Blogbeitrag anschauen

Brauchen wir eine neue Digitale Agenda?
19. April 2017
Offene Fragen, auf die es noch keine überzeugenden Antworten gibt, sind geblieben. Sie zeigen, dass nicht alle Probleme gelöst sind. Von Göttrik Wewer Die Wahlperiode neigt sich dem Ende zu. Was der Gesetzgeber bis zur Sommerpause nicht unter Dach und Fach gebracht hat, das kommt nicht mehr, denn dann dominiert der Wahlkampf. Der wird nur […]
Blogbeitrag anschauen

Fake News und „alternative Fakten“
5. April 2017
Wie sozial schädlich Falschmeldungen tatsächlich sind. Man könnte fast sagen: Sie gehören zum Leben. Was tun? Von Peter Schaar In den Medien mehren sich Befürchtungen, die in diesem Jahr stattfindenden Wahlen in Europa könnten durch Fake News beeinflusst werden. Solche Befürchtungen erscheinen begründet – insbesondere vor dem Hintergrund des jüngsten US-Wahlkampfs. Vieles spricht dafür, dass […]
Blogbeitrag anschauen

Frisst die digitale Revolution ihre Kinder?
29. März 2017
Prognose 1999 und Wirklichkeit 2017 im Vergleich von Horst W. Opaschowski REAL. DIGITAL. ILLEGAL. – Datensicherheit ist eine Illusion Prognose 1999 1999 wurde eine „neue Cyberwelt“ mit einer „fast anarchischen globalen Verknüpfung von Netzwerken“ vorausgesagt. Vierzehn Jahre vor Edward Snowden und der NSA-Affäre (2013) wurde als „Bedrohung der nationalen Sicherheit“ prognostiziert: „Die Manipulation durch Hacker“. […]
Blogbeitrag anschauen

Gefahr: Radikalisierung durch das Internet
19. Januar 2017
Erstmalig vorgenommene Literaturanalyse zeigt, wie und warum vor allem Jugendliche für die Propaganda aus dem Netz empfänglich sind. Von Gertraud Koch Der Verfassungsschutzbericht 2015 zeigt einen deutlichen Zulauf und eine höhere Mobilisierungsfähigkeit der rechtsextremen Szene in Deutschland auf. Viele der Täter sind noch sehr jung. Angesichts der vorgekommenen Anschläge bleibt im Nachgang völlig offen, wann […]
Blogbeitrag anschauen

Internet of Things – die Zukunft hat uns eingeholt
12. Januar 2017
Keine Grenzen für mögliche Anwendungsszenarien. Steigerung bereits existierender Prozesse. Ermöglichung neuer Geschäftsmodelle. Aber auch jede Menge Hindernisse.
Mitten in der heißen Phase des US-Wahlkampfs sorgte ein Ausfall weiter Teile des Internets für besonders viel Aufregung und Verunsicherung in Nordamerika. […]
Blogbeitrag anschauen

Die digitalen Lebenswelten der über 60-Jährigen in Deutschland
6. Januar 2017
Neue Studie vorgestellt. Tiefer Graben zwischen Onlinern und Offlinern. Wunsch nach digitaler Teilhabe steigt weiter. Von Joanna Schmölz Während die einen umfassend in der digitalen Welt angekommen sind, machen andere einen Riesenbogen um sie. Manche wollen an dem teilhaben, was im Internet geschieht, können aber nicht; andere wiederum könnten, wollen aber partout nicht. So unterschiedlich […]
Blogbeitrag anschauen

Der digitale Imperialismus und die Schwäche des Rechts
29. Dezember 2016
Der „Geist der Maschine“ ist der Flasche entwichen – es gibt kein Fangnetz mehr. Von Friedrich Graf von Westphalen Das Wort vom „digitalen Imperialismus“ reimt sich auf die nicht zu bändigende Wirtschaftskraft der Internet-Giganten des Silicon Valley, die „Big Data“ repräsentieren, Google, Facebook, Apple, Microsoft und Amazon: sie verkörpern aber auch gleichzeitig „Big Money“. Eine […]
Blogbeitrag anschauen

Demokratie im digitalen Zeitalter
20. Dezember 2016
Nicht alles technisch Mögliche ist auch rechtlich zulässig. Ohne eine Fortentwicklung des Grundgesetzes wird die Kluft zwischen praktizierter Demokratie und grundgesetzlichen Regelungen immer größer werden. von Sönke E. Schulz Das demokratische Prinzip musste sich seit jeher neuen Herausforderungen stellen. Dies gilt angesichts der Dimension des aktuellen gesellschaftlichen Strukturwandels auch und gerade für die Folgen der […]
Blogbeitrag anschauen

Chinese Walls 2.0 oder Trennung?
31. Oktober 2016
Digitale Zahlungsdienste werden immer öfter genutzt. Doch vieles ist für den Verbraucher nicht transparent. Von Andreas Oehler, Matthias Horn und Stefan Wendt Akzeptanz und Bedeutung von Internet-Zahlverfahren sind bei Verbrauchern in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Als Hauptgrund wird meist der höhere Komfort der digitalen Welt im Vergleich zu den analogen Alternativen angeführt. Die fortschreitende […]
Blogbeitrag anschauen

Wider die deutsche Kleinstaaterei im Datenschutz!
24. Oktober 2016
Höchste Zeit, den Streit für Änderungen zu beginnen – das Thema darf kein Tabu bleiben. Von Göttrik Wewer Wir regen uns gerne darüber auf, dass die Amerikaner ein ganz anderes Verständnis von Privatheit und Datenschutz haben und es deshalb so schwierig ist, mit ihnen zu einer Verständigung zu kommen. Wer für sich in Anspruch nimmt, […]
Blogbeitrag anschauen

Das Internet ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen
10. Oktober 2016
Was bedeutet die fortschreitende Digitalisierung für die digitalen Lebenswelten? Neue Studie vorgelegt Von Maximilian von Schwartz Vier Jahre nach Veröffentlichung der ersten DIVSI Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet stellte das DIVSI gemeinsam mit dem SINUS-Institut am 28. Juni in Berlin die aktualisierten DIVSI Internet-Milieus 2016 vor. Die Studie zeigt auf, dass die Digitalisierung […]
Blogbeitrag anschauen

Mit viel Datenverkehr zu weniger Stau?
7. Oktober 2016
Digitale urbane Mobilität: Die Ziele sind in Sicht, doch den Weg säumen Hindernisse. Über die „Digitalisierung des Verkehrs“ läuft derzeit auch international eine hitzige öffentliche Diskussion in Wirtschaft, Politik und Medien, die sich mit einer Vielzahl von bekannten und neuen Schlagworten um einen gesellschaftlichen Dauerbrenner dreht: die Erhaltung einer umfassenden Mobilität von Menschen und Gütern in unserer modernen, innovationsoffenen, ressourcenschonenden und verantwortungsbewussten Welt.
Blogbeitrag anschauen

Internet und Partisanenkrieg aus dem Keller
9. Mai 2016
Er sieht Gefahren. Dennoch ist der Experte überzeugt: Das Positive am Netz wird vermutlich immer überwiegen. Dr. Karsten Nohl im Interview zu Fragen um Hacking, Cyberterrorismus und das Internet der Dinge. Karsten Nohl gehört zu den bekanntesten Kryptografen unserer Zeit. Zu seinen Forschungsgebieten zählen GSM-Sicherheit, RFID-Sicherheit und der Schutz der Privatsphäre. Seit 2010 ist er […]
Blogbeitrag anschauen

Bürger und Amt: Wobei entstehen die meisten Kontakte?
3. Mai 2016
Untersuchung zu den 100 wichtigsten und am häufigsten genutzten Verwaltungsleistungen ist abgeschlossen. Die Regierungskoalition im Bund hat zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode das ambitionierte Ziel vereinbart, die „100 wichtigsten und am häufigsten genutzten Verwaltungsleistungen innerhalb der nächsten vier Jahre bundesweit einheitlich online anzubieten“. Offen blieb, welche Leistungen dies eigentlich sind.
Blogbeitrag anschauen

Im neuen Zeitalter der Nachrichtendienste
29. April 2016
Der NSA-Untersuchungsausschuss: Kristallisationspunkt für gesellschaftliche Debatten rund um das Gleichgewicht von Sicherheit und Freiheit in der digitalen Welt. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Ende des Kalten Krieges schien es, als wäre die Hochzeit der Geheimdienste vorbei. Die Rüstungsprojekte der Staaten wurden immer teurer, und insbesondere die USA konnten es sich leisten, eine ganz ungewohnte Transparenz zu praktizieren.
Blogbeitrag anschauen

DIVSI Direktor Matthias Kammer im Interview zum digitalen Wandel
1. April 2016
Kürzlich war DIVSI-Direktor Matthias Kammer zu Gast im alpha-Forum. In der Sendung sprach er mit Isabella Schmid über die neuen Chancen und Risiken des digitalen Wandels. Privatsphäre Gerade nach den Snowden-Leaks sei, so Kammers Eindruck, die Wertschätzung von Privatsphäre enorm gestiegen. Jedoch trete hier ein gewisses Paradoxon auf, wenn 80 Prozent der Menschen angeben, dass […]
Blogbeitrag anschauen

Big Data in der medizinischen Praxis – die Zukunft hat begonnen
29. Januar 2016
Diese Entwicklung unterliegt einer Eigendynamik, die sich per se nicht unterdrücken lässt. Dr. Franz Bartmann Im Zusammenhang mit Big Data wird in ganz unterschiedlichen Bereichen von enormen Potenzialen gesprochen. Dabei haben die sich bietenden Möglichkeiten natürlich auch Einfluss auf die Medizin. Wobei die Diskussion über Big Data im Gesundheitsbereich bisher noch ohne eine erkennbare strukturierte […]
Blogbeitrag anschauen

Hackathon – Bessere Ideen als bei Start-Ups
18. Januar 2016
Zum 3. Mal Begeisterung bei „Jugend hackt“: Mit Code die Welt verbessern. Von Stephanie Weber Schon immer übten Computer eine unheimliche Faszination auf mich aus. Nach der Schule spielte ich Pong auf dem Röhrenbildschirm unseres Heimcomputers, später schlug ich sogar meinen kleinen Bruder bei Rennspielen auf der Spielekonsole. Was „Internet“ bedeutet, war mir anfangs nicht […]
Blogbeitrag anschauen

Das EuGH-Urteil im Meinungsspiegel – so denken US-Experten
8. Januar 2016
Wertvolle Erkenntnisse, gewonnen bei der Informationsreise einer Fachdelegation nach Washington. Von Matthias Kammer Reiner Jubel über den Spruch des EuGH zu Safe Harbor dürfte fehl am Platze sein. Wenn es laut Richterspruch künftig untersagt ist, personenbezogene Daten aus der EU in die USA zu übermitteln, da diese kein Land mit hinreichendem Datenschutzniveau seien, darf man […]
Blogbeitrag anschauen

Reformbedarf beim Datenschutzrecht
18. Dezember 2015
Schutzmechanismen wirkungslos, ineffektive Regelungen, wirtschaftlicher Wert nicht berücksichtigt. Von Johanna Jöns Das derzeitige Datenschutzrecht wird den aktuellen Entwicklungen der Datenwirtschaft nicht mehr gerecht. Diese Entwicklung beruht auf der zunehmenden Kommerzialisierung von Daten, die bei Nutzung moderner Devices anfallen. Es liegt insoweit ein dringender Reformbedarf vor. Sowohl die datenschutzrechtliche Einwilligung als auch die Datenschutzprinzipien sind in […]
Blogbeitrag anschauen

Wie sicher sind WhatsApp, iMessage und Co.?
27. November 2015
Von Yi-Ji Lu Instant Messenger haben sich mittlerweile zu einem Standard in der digitalen Kommunikation entwickelt. So nutzen 73 Prozent der deutschen Internet-User laut der kürzlich erschienenen DIVSI AGB-Umfrage Messenger für ihre Kommunikation. Unter den genutzten Applikationen führt WhatsApp mit 68,7 Prozent die Liste deutlich an. Danach folgen weit abgeschlagen Snapchat (5,8 Prozent), Threema (4,7 Prozent), SIMSme (3,7 Prozent), Telegram (3,6 Prozent), Viber […]
Blogbeitrag anschauen

Soziale Netzwerke als Nachrichtenquelle immer beliebter
23. November 2015
Soziale Netzwerke sind inzwischen zu wichtigen Informationskanälen für tagesaktuelle Nachrichten avanciert. Das belegt eine neue repräsentative BITKOM-Umfrage, die mit 1.042 Internetnutzern ab 14 Jahren in Deutschland durchgeführt wurde. Demnach konsumieren 22 Prozent der Internetnutzer tagesaktuelle Nachrichten über Social Media. Auffällig ist, dass besonders die jüngere Altersgruppe von 14 bis 29 Jahren mit 32 Prozent die sozialen Kanäle für diese Zwecke oft […]
Blogbeitrag anschauen

Internet-Kriminalität – für alle eine Herausforderung
13. November 2015
Phishing und Identitätsdiebstahl liegen an der Spitze. Caroline von der Heyden und Dr. Johannes Rieckmann Zur Darstellung der Lage und Entwicklung der Kriminalität in Deutschland wird üblicherweise die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) herangezogen. Diese bildet ausschließlich das sogenannte Hellfeld ab – also die Fallzahlen von der Polizei durch Anzeige oder eigene Ermittlungen bekannt gewordenen Straftaten. Um […]
Blogbeitrag anschauen

Zahlungsbereitschaft für Datenschutz steigt
6. November 2015
Von Yi-Ji Lu Jeder Zweite würde für besseren Datenschutz Geld ausgeben. Das bestätigt eine repräsentative Umfrage mit 1.009 Teilnehmern, die der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zusammen mit TNS Emnid durchgeführt hat. Fünf Euro oder mehr für Datenschutz 51 Prozent sind laut der Umfrage bereit, Geld zu zahlen, wenn sie im Gegenzug bei zuvor kostenlos genutzten sozialen Netzwerken oder E-Mail-Diensten mehr Datenschutz […]
Blogbeitrag anschauen

GMail, GMX, WhatsApp und das Kleingedruckte
30. Oktober 2015
Wie Nutzer mit den AGB von Kommunikationsdienstleistern umgehen. Von Susanne Fittkau Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise von Anbietern im Internet“: Kaum einer hat die seitenlangen Texte jemals gelesen. Doch jeder klickt sie bestätigend an, denn ohne läuft gar nichts. Wer bestimmte Dienste und Services nutzen will, ist zur Zustimmung gezwungen. Das Kleingedruckte bei populären Messengern wie […]
Blogbeitrag anschauen

Informierte Einwilligung oder blinde Zustimmung?
26. Oktober 2015
Gedanken zu AGB, Datenschutz, Vertrauen und Sicherheit im Internet. Von Dr. Göttrik Wewer Wer einen der vielen, häufig kostenlosen Dienste im Internet nutzen möchte, muss in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters einwilligen, zu denen auch die Bestimmungen zum Datenschutz gehören. Die meisten bestätigen, diese Texte gelesen zu haben, und stimmen ihnen zu, ohne das […]
Blogbeitrag anschauen

ARD/ZDF-Onlinestudie 2015: 80 Prozent der Deutschen online
19. Oktober 2015
Von Yi-Ji Lu Fast 80 Prozent der Deutschen sind online. Zu diesem Ergebnis kommt die neue repräsentative ARD/ZDF-Onlinestudie 2015, für die bundesweit 1.8000 Deutsche ab 14 Jahren befragt wurden. Die Anzahl der Internetnutzer hat sich gegenüber dem Vorjahr nur marginal erhöht. Mit einer Steigerung von 79,1 Prozent auf 79,5 Prozent ist der Anstieg von Internet-Usern zwar vergleichsweise gering, eine […]
Blogbeitrag anschauen

Beteiligung im Internet: Im Prinzip sind alle dabei!
16. Oktober 2015
Neue DIVSI Studie zeigt ganz unterschiedliche Sichtweisen in den verschiedenen Milieus. Von Meike Otternberg Deutsche Internet-Nutzer sind auf einer Reihe von Feldern aktiv im Netz dabei. Sie nutzen es für Teilhabe an Kultur, Bildung, Gesundheit und Wirtschaft. Häufig findet Beteiligung im wirtschaftlichen Kontext statt, aber auch in Verbindung mit Hobbys oder für zivilgesellschaftliche Anliegen. So […]
Blogbeitrag anschauen

Suchmaschinen zwischen Personalisierung und Ergebnis-Vielfalt
13. Oktober 2015
Google und die Internet-Suche: Speicherung der Nutzerdaten zur Steigerung der Effizienz? Erkenntnisse einer Bachelorarbeit an der Uni Erfurt. Von Projektgruppe „Zufallstreffer“ Die gezielte Suche nach Informationen hat sich in der Zeit digitaler Medien auf das Internet verlagert. Rund 82 Prozent der deutschen Bevölkerung nutzen Suchmaschinen mindestens einmal wöchentlich zu Informationszwecken. Diese durchkämmen die scheinbar unendliche […]
Blogbeitrag anschauen

Internetnutzung und digitale Gräben: Status quo 2015
25. September 2015
Ein Internetzugang ist für viele Erledigungen im Alltag mittlerweile unentbehrlich: von Shopping über Kommunikation, Nachrichten und Entertainment hin zu neuen E-Government-Modellen – alles verlagert sich schrittweise in die digitale Welt. Auch wenn die Mehrheit mittlerweile über einen Internetzugang verfügt, verlaufen dennoch deutliche digitale Gräben entlang bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, wie Lee Rainie vom Pew Research Center in einer Datenauswertung […]
Blogbeitrag anschauen

Spaltet das Netz die Gesellschaft?
18. September 2015
Ein Kommentar von Prof. Dr. Christian Hoffmann Das Internet bietet zahllose Vorzüge und Bequemlichkeiten. Wir haben uns an sie gewöhnt, ja können uns ein Leben ohne sie kaum noch vorstellen. Doch möglicherweise ist das Internet zugleich eine Ursache für gesellschaftliche Spaltung. Seit den 90er Jahren geht in Wissenschaft und Politik die Angst um vor einer„digitalen […]
Blogbeitrag anschauen

Online-Kanäle sind essentiell für die soziale Interaktion von Teenagern
13. August 2015
Von Yi-Ji Lu Das Zusammenleben von Jugendlichen spielt sich zu großem Teil online ab. Das zeigt eine neue Studie des Pew Research Center, für die US-weit 1.060 Teenager zwischen 13 und 17 Jahren befragt wurden. Jeder Zweite schließt Online-Freundschaften In dieser Altersgruppe entstehen Freundschaften verstärkt im Internet. 57 Prozent der Befragten geben an, dass sie bisher […]
Blogbeitrag anschauen

Lage der IT-Sicherheit in Deutschland
10. August 2015
Angriffe mit kriminellem Hintergrund sind eine größere Bedrohung als Angriffe mit einem nachrichtendienstlichen Hintergrund. Von Michael Hange Die millionenfachen Identitätsdiebstähle von Bürgern, Meldungen zu Cyberangriffen auf Wirtschaftsunternehmen und nicht zuletzt die Snowden-Enthüllungen haben weit über die Expertenebene hinaus das Bewusstsein der Verletzbarkeit im Cyberraum deutlich gemacht. Insbesondere ist klar geworden, dass alle Gesellschaftsgruppen hiervon betroffen sind. […]
Blogbeitrag anschauen

Deutschland hinkt bei E-Government hinterher
5. August 2015
Von Yi-Ji Lu Die Nutzung elektronischer Verwaltungsangebote in Deutschland hinkt im Vergleich mit anderen Ländern deutlich hinterher. Das ergab die kürzlich von der Initiative D21 e.V. und dem Ipima (Institute for Public Information Management) vorgestellte repräsentative Studie „E-Government-Monitor 2015„, für die 1.000 Online-Interviews in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden durchgeführt wurden. Genereller Zuwachs in E-Government-Nutzung – Deutschland bildet die […]
Blogbeitrag anschauen

Digitale Teilhabe bedeutet soziale Teilhabe
3. August 2015
Warum wir wissen sollten, wie die 3- bis 8-Jährigen mit dem Thema Internet umgehen. Von Joanna Schmölz Das Thema „Kinder und Internet“ ist hochaktuell. Die einen meinen, Kinder müssten so lange wie möglich von der digitalen Welt ferngehalten werden. Die anderen verlangen Tablets in der Kita und Programmieren/Coding bereits in den ersten Schuljahren. Facettenreich wird […]
Blogbeitrag anschauen

Behavioral Profiling: So lassen sich User anhand von Tastenanschlägen identifizieren
30. Juli 2015
Von Yi-Ji Lu Sicherheitsforscher haben ein Verfahren zur Auswertung von Tastatureingaben entwickelt, das User anhand ihres Tippverhaltens eindeutig identifizieren soll – auch wenn sie Anonymisierungstools wie Tor nutzen. Ein auf einer Website eingebautes Skript misst initial die Texteingaben und erstellt aus der Länge der Pause zwischen Tastaturanschlägen und der Dauer einer gedrückten Taste einen einzigartigen digitalen Fingerabdruck, anhand dessen […]
Blogbeitrag anschauen

Jugend entdeckt das Internet neu
29. Juli 2015
Your Net – DIVSI Convention 2015: Hamburger Kongress ein voller Erfolg. Zwei Tage lernen, diskutieren, Spaß haben. Von Tom Solbrig Über Nana Domenas Gesicht kullern große Schweißperlen. Er ist voller Energie. Um ihn herum Sand, Palmen und euphorische Menschen. Der aus Ghana stammende Moderator hat soeben mit Matthias Kammer, Direktor des Deutschen Instituts für Vertrauen und […]
Blogbeitrag anschauen

Umparken im Kopf?
3. Juli 2015
Vom blinden Vertrauen zu etwas, dem man eigentlich nicht traut. Von Dr. Göttrik Wewer Vertrauen, so heißt es allenthalben, ist der Schlüssel für die digitale Wirtschaft. Wenn die Menschen sich im Internet nicht sicher fühlen und den Angeboten nicht trauen, die ihnen dort gemacht werden, dann werden sie diese nicht nutzen, so schön das technisch […]
Blogbeitrag anschauen

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig stellt die DIVSI U9-Studie vor
26. Juni 2015
Auf der Bundespressekonferenz vergangenen Dienstag stellte die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig gemeinsam mit DIVSI und dem SINUS Institut die neue DIVSI U9-Studie: Kinder in der digitalen Welt vor. Keine Frage der Technik, sondern eine Frage des Umgangs Anstatt vor den Risiken im Internet zu mahnen, betonte die Bundesfamilienministerin die Chancen der digitalen Welt und hob Mediensozialisierung und Vermittlung von Medienkompetenz als […]
Blogbeitrag anschauen

Schwächstes Glied ist oft der Mensch
5. Juni 2015
Das IKT-Nutzerverhalten hat grundlegenden Einfluss auf Datensicherheit. Von Carsten J. Pinnow Unsere Gesellschaft befindet sich derzeit in einer folgenreichen Umbruchphase – nahezu kein Lebensbereich wird sich der Digitalisierung und Vernetzung entziehen können. Das Internet ist zur Lebensader moderner Gesellschaften geworden, denn beinahe alle Bereiche hängen von dessen einwandfreier Funktion ab. Hier sind insbesondere die kritischen […]
Blogbeitrag anschauen

Recht auf Vergessen – die Standpunkte der Teilnehmer
30. März 2015
Am 26.03.2015 fand in Berlin unsere Diskussionsveranstaltung „Vergiss es, Du wirst mich nie wieder los – Sollte das Internet vergessen?“ statt. Wir danken allen Gästen für die rege Teilnahme und den Referenten für die spannenden Einblicke und Diskussionen. Für alle, die nicht mit dabei sein konnten, haben wir hier einen Einblick zusammengestellt. Hier geht es zur Pressemitteilung. Zusammenfassung […]
Blogbeitrag anschauen

Nachrichten für Millenials wichtig aber nur Teil einer breiten Mediennutzung
19. März 2015
In Zeiten von Snapchat, Multi-Tasking und befürchteten Aufmerksamkeitsdefiziten durch Medienüberlastung hat sich die Sorge verbreitet, dass das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Interesse junger Internetnutzer immer weiter abnimmt. Eine neue Studie des Media Insight Project zeigt jedoch, dass die Millennials dem Weltgeschehen keineswegs ignorant gegenüberstehen. Aktuelle Nachrichten werden von 85% der Befragten als wichtig erachtet und von 69% […]
Blogbeitrag anschauen

Your Net – DIVSI Convention 2015: Jetzt anmelden!
5. März 2015
DIVSI startet Website zum Kongress „Zukunft der digitalen Welt“ für Jugendliche und junge Erwachsene Ab sofort sind auf unserer Your Net – DIVSI Convention 2015 Website alle Informationen rund um das Programm, die Speaker und Anmeldung zu finden. Hier kann man sich auch schon einmal einen Eindruck von der entspannten Beach-Location machen. Auf unserer zugehörigen Facebook-Seite berichten wir zudem stets über Neuigkeiten und Hintergrundinformationen. […]
Blogbeitrag anschauen

Symposium: Neue Macht- und Verantwortungsstrukturen in der digitalen Welt
11. Februar 2015
Die Digitalisierung aller Lebensbereiche hat einen Veränderungsprozess der Macht- und Verantwortungsstrukturen in Gang gesetzt und stellt Staat, Politik und Recht gleichermaßen vor immense neue Herausforderungen. Insbesondere die rasant wachsende Menge an sensiblen und gleichzeitig für viele Akteure wirtschaftlich hoch wertvollen Daten wirft die gesellschaftlich immer dringlicher werdende Frage auf, wie ein verantwortungsbewusster Umgang zwischen Staat, […]
Blogbeitrag anschauen

MIT-Forscher widerlegen Anonymität von Metadaten
5. Februar 2015
Metadaten erlauben detaillierte Einblicke in sensible Informationen und ermöglichen die Erstellung von User-Profilen. Das zeigte u.a. schon Politiker Malte Spitz und Netzaktivist Ton Siedsma in Selbstexperimenten. Nun belegt auch eine MIT-Studie (veröffentlicht im Science Magazin), dass Kreditkarteninhaber leicht anhand vermeintlich anonymer Metadaten identifiziert werden können. Das Forscherteam um Yves-Alexandre de Montjoye analysierte hierfür in einem Zeitraum von drei Monaten […]
Blogbeitrag anschauen

8-Punkte-Plan für weltweiten Datenschutz – Empfehlungen der EFF
29. Januar 2015
Die US-Bürgerrechtsorganisation „Electronic Frontier Foundation“ (EFF) setzt sich für digitale Grundrechte in den USA ein. Als zentrales Problem identiziert die EFF das globale Ausmaß der NSA-Überwachung. Zwar können sich US-Bürger vor Gericht auf die US-Verfassung berufen und sich gegen die Überwachung zur Wehr setzen, doch Internetnutzern im Ausland bleibt diese Möglichkeit verwehrt, obwohl sie durch die NSA-Kooperation mit […]
Blogbeitrag anschauen

Sicherheit immer in Relation zum Aufwand sehen
9. Januar 2015
Teil 2: Technische, rechtliche und kulturelle Fragestellungen müssen geklärt und optimiert werden. Digitale Realpolitik für die Cloud-Gesellschaft – Teil 1 des Beitrags veröffentlichten wir im letzten Magazin. Heute ergänzt der Autor seine Gedanken um drei Punkte. Von Dr. Philipp Müller.
Blogbeitrag anschauen

Internet – Mehr als ein Info-Medium
30. Dezember 2014
Hamburg – Vor voll besetzten Reihen referierten Joanna Schmölz, wissenschaftliche Leiterin von DIVSI, und Projektleiterin Meike Demattio im Rahmen einer öffentlichen Vorlesung in der Hamburger Universität. Bei dieser Veranstaltung im Rahmen des Allgemeinen Vorlesungswesens ging es um die DIVSI U25-Studie im Allgemeinen sowie um „Perspektiven auf pädagogische und didaktische Potenziale privater, mobiler Endgeräte in der Schule“ im Speziellen.
Blogbeitrag anschauen

DIVSI Studie: Daten – Ware und Währung
16. Dezember 2014
Am liebsten umsonst – die deutschen Internet-Nutzer bevorzugen eindeutig kostenlose Online-Angebote. 76 Prozent der User greifen ausschließlich oder vor allem auf Angebote zurück, für die nicht bezahlt werden muss. Nur gut jeder Fünfte nutzt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Online-Angebote. 75 Prozent der Befragten sind sich allerdings auch der Tatsache bewusst, dass sie für diese kostenlosen Online-Angebote in der Regel mit ihren persönlichen Daten bezahlen müssen.
Blogbeitrag anschauen

Initiative D21-Studie: Potenzial von mobilem Internet und LTE unausgeschöpft
11. Dezember 2014
Von Yi-Ji Lu Welchen Einfluss hat das mobile Internet auf unsere Lebensgewohnheiten, unsere Kommunikation und Werte? Seit 2012 führen die Initiative D21 e.V. und Huawei gemeinsam mit TNS Infratest die repräsentative Studie „Mobile Internetnutzung“ durch, um gesellschaftliche und technische Entwicklungen im Kontext der mobilen Internetnutzung im Zeitverlauf zu verstehen. Vergangene Woche präsentierten Lena-Sophie Müller (Initiative D21 e.V.), Ingoberth Veith (Huawei Technologies […]
Blogbeitrag anschauen

Änderung im DIVSI-Beirat
5. Dezember 2014
Zum Ausscheiden von Prof. Dr. Miriam Meckel. Von Matthias Kammer Danke, liebe Miriam Meckel! Danke für zweieinhalb Jahre engagierte Mitarbeit im DIVSI-Beirat, dem Sie seit seiner Gründung angehört haben. Warum Sie als viel beschäftigte Professorin sich für die Ziele unseres Instituts so stark eingesetzt haben, begründeten Sie seinerzeit in einem Interview so: „DIVSI will auf […]
Blogbeitrag anschauen

Ipsos-CIGI-Umfrage: Deutschland – Land der Internetskeptiker?
1. Dezember 2014
Seit den Snowden-Enthüllungen ist das Vertrauen in das Internet und die Internetsicherheit deutlich gesunken. Das zeigt eine internationale Umfrage, die das kanadische Centre for International Governance Innovation (CIGI) zusammen mit dem Ipsos Forschungsinstitut durchgeführt hat. Befragt wurden 23.000 Internetnutzer in 24 Ländern zwischen 16 und 64 Jahren.
Blogbeitrag anschauen

Daten – Ware und Währung?
So denken die deutschen Internetnutzer [Infografik]
17. November 2014
Seit Facebook, Amazon und Google ist es kein Geheimnis mehr, dass persönliche Userdaten zur Ware und Währung im Internet geworden sind. Wie vielen deutschen Internetnutzern ist dieses aber tatsächlich bewusst? Was denken sie über Weiterverwendung ihrer Daten im Internet? Sind die Nutzer vielleicht bereit, statt Ihre Daten herzugeben, Geld für bisher kostenlose Dienste zu bezahlen? […]
Blogbeitrag anschauen

Wissenswertes über den Umgang mit Smartphones [Infografik]
4. November 2014
Über Smartphones sind Menschen heute nahezu ununterbrochen über das Internet miteinander verbunden. Ganz mobil haben wir Zugriff auf unterschiedliche Dienste, die das Leben erleichtern. Mit steigendem Nutzungsumfang fällt dabei eine Vielzahl von Daten an und bildet sich ein umso umfangreicheres „digitales Spiegelbild“. Doch: Was geschieht mit meinen Daten? Unter dieser Leitfrage war es Ziel der […]
Blogbeitrag anschauen

Ein Vorbild für viele
29. Oktober 2014
Prof. Dr. Claudia Eckert gehört zu „Deutschlands digitalen Köpfen“. Von Jürgen Selonke Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) hat im Wissenschaftsjahr 2014 gemeinsam mit führenden digitalen Experten und den wichtigsten Verbänden und Organisationen der IT-Branche „Deutschlands digitale Köpfe“ gesucht und gefunden. Zu den Preisträgern gehören 39 Frauen und Männer aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die […]
Blogbeitrag anschauen

Aktiv werden – Grundrechte verteidigen
27. Oktober 2014
Vom digitalen Wettrüsten, Datenschutz-Guerilla und Bewusstseinsbildung. Max Schrems Der Kampf um unsere Daten hat erst begonnen. Wir müssen jetzt mit Hochdruck daran arbeiten, dass sich unser Grundrecht auf Privatsphäre nicht im Zuge der Digitalisierung auflöst. Sehen wir weiter zu, wie Datenschutz nur auf dem Papier existiert, riskiert Europa, jede Glaubwürdigkeit in diesem Bereich zu verlieren. […]
Blogbeitrag anschauen

30 Jahre – Spielt die E-Mail auch künftig eine Rolle?
22. Oktober 2014
Vor 30 Jahren fing alles an. Persönliche Gedanken von dem Mann, der bei uns als Erster einen elektronischen Brief empfing. Von Prof. Michael Rotert Vor 30 Jahren, genauer am 3. August 1984, ging der erste Internet-Mailserver in Deutschland in Betrieb. Den Startschuss dazu markierte eine E-Mail aus den USA, die ich erhielt und die den […]
Blogbeitrag anschauen

Digitale Realpolitik für die Cloud-Gesellschaft
16. Oktober 2014
Teil 1: Ungesundes Spannungsverhältnis zwischen der Politisierung des Themas und dem eher niedrigen Niveau des Diskurses. Von Dr. Philipp Müller Wir leben im Jahr 2014 in einem Zeitalter der Digitalisierung aller wesentlichen Infrastrukturen, Organisationen und Lebenswelten unserer Gesellschaft, auch wenn wir das im gesamtgesellschaftlichen Diskurs noch nicht voll und ganz realisiert haben. Wir fangen erst […]
Blogbeitrag anschauen

Lanier: Friedenspreis für Rückbesinnung auf traditionelle Macht- und Produktionsstrukturen?
13. Oktober 2014
Am Wochenende wurde dem Informatiker und Autor Jaron Lanier der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Lanier, der als Pionier des Internets Begriffe wie „Virtual Reality“ und damit das Internet als digitale Lebenswelt prägte, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der schärfsten Kritiker des Internets entwickelt. So ist die Preisverleihung des Deutschen Buchhandels an Lanier auch nur auf den ersten Blick überraschend, deckt sich doch die Skepsis breiter Branchenteile vor dem Hintergrund der tiefgreifenden Umwälzungen mit der Laniers.
Blogbeitrag anschauen

„Gute Schnittstellen zu den Ministerien gestalten!“
8. Oktober 2014
„Digital Champion“ Prof. Dr. Gesche Joost zu ihrer neuen Aufgabe, der NSA-Affäre und einer Traumvorstellung. Von Joanna Schmölz Gesche Joost, in Kiel geboren, ist seit 2011 Professorin an der Universität der Künste Berlin für das Fachgebiet Designforschung und seit Kurzem „Digital Champion“. Sie schätzt klare Worte – und bewies dies auch im DIVSI-Interview. DIVSI magazin: […]
Blogbeitrag anschauen

Typosquatting – wie aus Tippfehlern Geld gemacht wird
6. Oktober 2014
Von Yi-Ji Lu Typosquatting – so nennt sich eine Methode, um aus den Tippfehlern von Internet-Nutzern zu profitieren. Webseiten-Betreiber mieten hierbei zu bekannten Internetseiten ähnliche Domains an und hoffen auf Traffic durch Vertipper bei der URL-Eingabe. Typosquatting-Seiten können auf mehreren Ebenen von User-Fehleingaben ansetzen: Vertipper bei der URL-Eingabe (z.B.: www.wiipedia.org, www.eikipedia.org. www.wikipdia.org anstatt www.wikipedia.org) Abweichende Top-Level-Domain (z.B.: www.whitehouse.com anstatt www.whitehouse.gov) Alle […]
Blogbeitrag anschauen

Shellshock bedroht Unix-Systeme – schwerwiegender als Heartbleed?
1. Oktober 2014
Ein Team von Red Hat Security-Experten berichtete kürzlich in einem Blogartikel von der Entdeckung einer weitreichenden Sicherheitslücke in Unix-basierten Systemen. Die Sicherheitslücke mit Namen „Shellshock“ oder „Bash-Bug“ soll seit 1984 existieren und Hackern erlauben, Shell-Befehle auszuführen. Damit ist ein Hacker mit einfachen Mitteln in der Lage, Malware von der Ferne aus zu platzieren oder ganze Systeme zu übernehmen. Eine […]
Blogbeitrag anschauen

Digitaler Ausstieg – neues Lebenskonzept für Jugendliche?
25. September 2014
Unter den Jugendlichen formiere sich eine „Avantgarde von digitalen Aussteigern“, sagte Jugendkulturforscher Philipp Ikrath kürzlich am Rande des Kinderschutzforums in Köln. Die Gegenbewegung löse sich von der „totalen Umarmung des Digitalen“, die der jungen Generation gemeinhin nachgesagt wird, und schaffe bewusst eine Parallelsphäre, in der das Analoge, wie persönliche Freundschaften, Naturerlebnisse, Handwerkerarbeiten und Kochen gefeiert werden würde. […]
Blogbeitrag anschauen

Metadaten – was sie wirklich verraten
15. September 2014
Von Yi-Ji Lu Seit dem NSA-Skandal hat der Begriff „Metadaten“ Eingang in die tägliche Überwachungs- und Datenschutzdebatte gefunden. Obama rechtfertigte anfänglich die NSA-Überwachung mit der Aussage, dass die NSA keine Inhalte, sondern nur Metadaten sammle und diese keinen Einblick in intime Details ermöglichen würden. Was genau sind Metadaten und sind sie so harmlos, wie von der US-Politik zunächst behauptet? Was […]
Blogbeitrag anschauen

Prominente nackt im Netz: Ursachen und wie man sich schützt
8. September 2014
Vergangene Woche verbreiteten sich private Nacktfotos von weiblichen Prominenten wie Jennifer Lawrence und Model Kate Upton wie ein Lauffeuer im Netz. Die unbekannten Hacker luden die Bilder zuerst über die populären Content-Sharing-Plattformen 4chan, Reddit und Imgur hoch und drohten dann weiteren 100 Celebrities mit der Veröffentlichung ähnlicher Bilder. Schnell war der Apple-Dienst iCloud als Quelle der Fotos in aller Munde […]
Blogbeitrag anschauen

Matthias Kammer im Interview: Ausgespäht und abgehört
21. August 2014
Ein Jahr nach den NSA-Enthüllungen reagiert die Mehrheit der Deutschen gleichgültig auf die zunehmenden Berichte über die Spionage durch Geheimdienste. Nur jeder Zehnte ist vorsichtiger geworden – das zeigte unsere Umfrage anlässlich des Jahrestags der Snowden-Enthüllungen. Die zentralen Ergebnisse hatten wir in einer Infografik zusammengefasst. Jüngst befragte das zur dpa gehörende Unternehmen na news aktuell DIVSI-Direktor Matthias Kammer zu […]
Blogbeitrag anschauen

Privatsphäre-Problem Facebook-Messenger? Android-Vorschriften und Kontrolle via iOS
19. August 2014
Vor einigen Tagen hat Facebook die lang angekündigte Auslagerung des Nachrichtendienstes aus seiner App vorgenommen. Um die Facebook-Mitteilungen auf mobilen Geräten weiterhin zu nutzen, müssen die User nun die separate Messenger-App verwenden. Auch wenn sich Facebook mit dem Unbundling eine schlankere und nutzerfreundlichere App verspricht – der Zwang zur Nutzung einer weiteren App stieß erwartungsgemäß auf große Verärgerung und schlug sich […]
Blogbeitrag anschauen

30 Jahre E-Mail: wichtigstes Kommunikationsmedium der älteren Generation?
12. August 2014
Während die E-Mail-Nutzung unter Jugendlichen einen starken Rückgang verzeichnet und in dieser Altersgruppe im Vergleich zu SMS und Instant-Messaging kaum noch eine Relevanz hat, ist die Erfolgsgeschichte seit dem Versand der ersten E-Mail vor 30 Jahren beispiellos. Der Anteil der E-Mail-Nutzung an der Gesamtbevölkerung liegt in Deutschland gemäß einer aktuellen BITKOM-Studie bei 78 Prozent. Erstmalig wurde eine E-Mail am […]
Blogbeitrag anschauen

Passwort-Sicherheit in 6 Schritten
6. August 2014
Laut dem Sicherheitsunternehmen Hold Security hat eine russische Hackergruppe den bisher größten Datencoup der Internetgeschichte gelandet. Von über 420.000 Internetseiten wurden 1,2 Milliarden Login-Daten sowie über 500 Millionen E-Mail-Adressen gestohlen. Der Datenklau erfolgte via SQL-Injection – eine weithin bekannte Sicherheitslücke, die zum Standard der Absicherung gehört. Mittels Botnetzen (Netzwerke von infizierten Rechner) überprüften die Hacker die von Nutzern aufgerufenen Seiten nach der […]
Blogbeitrag anschauen

Canvas-Fingerprinting: wie funktioniert’s und wie verhindert man Tracking?
31. Juli 2014
Von Yi-Ji Lu Cookies stehen gemeinhin in schlechtem Ruf, dienen sie schließlich bei der Schaltung von personalisierten Werbeanzeigen der Nutzer-Identifikation und dem Tracking des Surfverhaltens. Aufgrund der möglichen Verletzung von Privatsphäre werden Cookies daher von Nutzern häufig geblockt oder regelmäßig gelöscht. Vergangene Woche hatte SPIEGEL ONLINE Canvas-Fingerprinting als Methode zum Online-Tracking vorgestellt, die „Verstecken fast unmöglich“ mache. Wie ist es um den Wahrheitsgehalt dieser Aussage bestellt und worum handelt es sich beim […]
Blogbeitrag anschauen

Studie zur E-Partizipation: Hochschulabsolventen zwischen 18-34 Jahren am aktivsten
28. Juli 2014
In Zusammenarbeit mit dem MCM-Institut der Universität St. Gallen haben wir im Frühjahr die DIVSI-Studie zu Bereichen und Formen der Beteiligung im Internet durchgeführt. Ziel war es, mit einem Forschungsüberblick ein Fundament für die Erforschung von Online-Partizipation zu legen. Im Zentrum der Studie stand die Frage nach den aktuellen Bereichen und Formen von Netzbeteiligung sowie ihren Vorraussetzungen und Folgen. Kürzlich veröffentlichte […]
Blogbeitrag anschauen

Balkanisierung, Kontrolle und Vertrauensverlust zentrale Risiken für digitales Leben
23. Juli 2014
Welche Herausforderungen und Risiken erwarten uns für das digitale Leben bis 2025? Pew Reseach befragte über 1,400 Technologieexperten und Internet-Analysten hinsichtlich ihrer Einschätzung zur Zukunft des Internets. Optimismus überwiegt Während 35 Prozent der befragten Experten von einer allgemeinen Verschlechterung der Rezipienz und Verbreitung von Inhalten durch die Nutzer ausgehen, geben sich 65 Prozent optimistisch: sie sehen diesbezüglich entweder keine Risiken […]
Blogbeitrag anschauen

EFF-Report: Wie schützen Unternehmen Kundendaten vor Regierungsanfragen?
21. Juli 2014
Unlängst veröffentlichte die Electronic Frontier Foundation (EFF) ihren diesjährigen Bericht „Who Has Your Back? Protecting Your Data from Government Request“. Jährlich untersucht die EFF, wie Internet-Unternehmen auf Aufforderungen der US-Regierung zur Herausgabe von Nutzerdaten reagieren. Anhand von sechs Kriterien wird gemessen, wie gut ein Unternehmen die Privatsphäre seiner Kunden schützt. Für jedes erfüllte Kriterium vergibt […]
Blogbeitrag anschauen

Mediennutzung und Medienkompetenz in jungen Lebenswelten
18. Juli 2014
Media Perspektiven hat in Zusammenarbeit mit dem SINUS-Institut eine repräsentative Umfrage zu den jugendlichen Lebenswelten durchgeführt. Dafür wurden 2001 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-29 Jahren zu vier Untersuchungsschwerpunkten befragt: Mediennutzung Gesprächspartner bei Medienthemen Glaubwürdigkeit von Medienaussagen Selbsteinschätzung hinsichtlich der eigenen Medienkompetenz sowie Computer- und Internetkompetenz Die Umfrage kam zu ähnlichen Resultaten wie unsere U25-Studie. Die […]
Blogbeitrag anschauen

Der staatliche Schutzauftrag im Wandel
14. Juli 2014
Gebietet es die staatliche Schutzpflicht für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme, Edward Snowden die Einreise nach Deutschland zu gestatten?
Blogbeitrag anschauen

Abhören? Egal, ich habe nichts zu verbergen!
11. Juli 2014
Ein Jahr nach den Snowden-Enthüllungen: Jeder Zehnte ist vorsichtiger geworden, die Mehrheit reagiert eher gleichgültig. Der Stein kam vor etwas mehr als einem Jahr ins Rollen. Am 9. Juni 2013, ein Sonntag. Es war der Tag, an dem die Weltöffentlichkeit erstmals den Namen Edward Snowden hörte. Für die einen ist Snowden ein Held, für die anderen ein Verräter. Was hat sich – ein Jahr nach seinen Enthüllungen – durch seine Aussagen für uns alle geändert? Privat und im allgemeinen Netzverhalten? Was fürchten wir, was lässt uns gleichgültig?
Blogbeitrag anschauen

Internet, Demokratie und Partizipation
9. Juli 2014
Engagieren sich Menschen politisch, nachdem sie das Internet für sich entdeckt haben? Oder nutzen sie das Netz jetzt auch für politische Zwecke, weil es manches erleichtert? Dr. Göttrik Wewer Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat das Wissenschaftsjahr 2014 unter das Motto „Die digitale Gesellschaft“ gestellt. Dazu gibt es im Laufe des Jahres viele Projekte […]
Blogbeitrag anschauen

Fünf Mythen zur Netzbeteiligung
7. Juli 2014
Aktuelle Untersuchung der Uni St. Gallen räumt auf mit Allgemeinplätzen Von Christian Hoffmann, Christoph Lutz, Miriam Meckel Alle sind ständig im Internet, aus privaten, politischen und tausend anderen Gründen. Doch wie steht es tatsächlich um die Beteiligung am Netz? Durch den Vormarsch von Digitalisierung und Vernetzung ist dieser Begriff zu einem Schlagwort avanciert und hat […]
Blogbeitrag anschauen

Rettungsanker im Strudel der Digitalisierung
3. Juli 2014
Natürlich können wir in unserer schönen Internet-Welt weitermachen wie bisher. Technisch funktioniert fast alles, die Möglichkeiten scheinen grenzenlos zu sein. Abhörorgien, Wirtschaftsspionage, Cybermobbing? Ich war noch kein Opfer, wird mancher denken. Doch das ist falsch. Viele Nutzer ahnen nicht, in welchem Umfang sie längst Opfer sind. Denn den meisten Menschen bleiben die Mechanismen der Macher verborgen. Ein Plädoyer für ein Instrument, das viele für nicht realisierbar hielten (halten) […]
Blogbeitrag anschauen

Deutschland braucht einen Digitalen Kodex
1. Juli 2014
Experten-Treffen in Berlin: Vom Straßenkampf auf eine andere Ebene kommen Von Jürgen Selonke Zur dritten öffentlichen Diskussion im Rahmen des Projekts „Digitaler Kodex“ hatte das DIVSI jetzt nach Berlin eingeladen. Der hochkarätig besetzte Info-Abend untersuchte vor voll besetzten Reihen in der „Kalkscheune“ die Frage: „Digitaler Straßenkampf oder Selbstverpflichtung – Wie entstehen Regeln im Netz?“ Hella Dunger-Löper, […]
Blogbeitrag anschauen

Handy-Überwachung und Selbstzensur: 88% fühlen sich in UK abgehört
23. Juni 2014
Vor einigen Tagen hat Vodafone öffentlich bekannt gegeben, dass eine Reihe von Regierungen direkten Zugang zu der globalen Infrastruktur des Telefonunternehmens besitzen. Sie sind damit in der Lage, Telefongespräche oder Internet-Traffic auch ohne Antrag oder Gerichtsbeschluss abzuhören. Daraufhin befragten OnePoll und Silent Circle 1.000 britische Nutzer, wie sie die Sicherheit ihrer Kommunikation einschätzen und welche […]
Blogbeitrag anschauen

Bewegungsprofile in Googles Android: wie man den Standortverlauf deaktiviert
20. Juni 2014
Wie wir bereits berichteten, protokolliert der iOS-Ortungsdienst „Häufige Orte“ im Detail, wo sich iPhone und Besitzer zu welchem Zeitpunkt aufgehalten haben. Dass Google ebenso detailliert Daten sammelt, wann und wo sich ein Android-Gerät und damit sein Nutzer befindet, dürfte für viele keine große Überraschung sein. Das Google-Tool Standortverlauf wird hingegen wohl nur den wenigsten bekannt sein. Hier hat der Nutzer […]
Blogbeitrag anschauen

Verschlüsselung sinnvoll – aber welche? Vor- und Nachteile von PGP, TOR und VPN
12. Juni 2014
Update 14.07.2014: Vielen Dank an Hauke Laging für die Hinweise: PGP-Verschlüsselung: Einige der im Artikel aufgelisteten Einschränkungen der PGP-Verschlüsselung lassen sich mit der Nutzung von OpenPGP beseitigen: OpenPGP verfügt wie S/MIME über die Möglichkeit der E-Mail-Signatur und funktioniert unabhängig von dem manipulierten RSA-Algorithmus. Mit dem Thunderbird-Plugin Enigmail lässt sich das Zertifikat ebenfalls in einer E-Mail […]
Blogbeitrag anschauen

Jahrestag der Snowden-Enthüllungen: ZDF-Politbarometer und DIVSI-Umfrage im Vergleich
5. Juni 2014
Anlässlich des Jahrestages der Snowden-Enthüllungen führten wir eine Umfrage zur Wahrnehmung des Snowden/NSA-Skandals durch. ZDF-Umfrage förderte ähnliche Ergebnisse zutage Das ZDF-Politbarometer förderte nun ähnliche Ergebnisse zutage, zeigte in einzelnen Dimensionen jedoch auch signifikante Abweichungen: ein Viertel bis Fünftel der deutschen Bevölkerung hat sein Nutzungsverhalten nach den Snowden-Enthüllungen geändert: 20% (ZDF) vs. 23% (DIVSI) bei der Mehrheit blieb das Nutzungsverhalten […]
Blogbeitrag anschauen

Pew Research Studie: So reagierten User auf den OpenSSL Heartbleed-Bug
20. Mai 2014
Im April versetzte der OpenSSL Heartbleed-Bug das Internet in einen Ausnahmezustand. Betroffen waren gut 30% aller SSL-Verbindungen weltweit, unter anderem Internet-Giganten wie Yahoo, Microsoft und Google. Der zwei Jahre lang unentdeckt gebliebene OpenSSL-Bug ermöglichte den Zugriff auf den Arbeitsspeicher von Servern und damit das Auslesen von Private Keys. Im Besitz dieser Keys wären Hacker in der Lage […]
Blogbeitrag anschauen

Regeln für das Netz
10. Mai 2014
Von Matthias Kammer Natürlich können wir in unserer schönen Internet-Welt weitermachen wie bisher. Technisch funktioniert fast alles, die Möglichkeiten scheinen grenzenlos zu sein. Abhörorgien, Wirtschaftsspionage, Cybermobbing? Ich war noch kein Opfer, wird mancher denken. Doch das ist falsch. Viele Nutzer ahnen nicht, in welchem Umfang sie längst Opfer sind. Denn den meisten Menschen bleiben die […]
Blogbeitrag anschauen

OpenSSL-Heartbleed-Bug: betroffene Websites und was zu tun ist
10. April 2014
Der vergangenen Montag festgestellte OpenSSL-Bug (wir berichteten) zieht weite Kreise. Sicherheitsexperte Bruce Schneier, gemeinhin nicht gerade für Panikmache bekannt, stuft diesen Bug auf einer Skala von 1 bis 10 mit 11 ein – „katastrophal“. Der Expertentenor ist einhellig: Heartbleed ist eines der größten Sicherheitsprobleme, die das Internet bislang gesehen hat. Was ist zu tun? Wie […]
Blogbeitrag anschauen

Internet-Schwarzmarkt profitabler als Drogenhandel
1. April 2014
Cyberkriminalität ist erwachsen geworden. Das zeigt die Studie Markets for Cybercrime Tools and Stolen Data: Hackers‘ Bazaar der RAND Corporation. Bis vor wenigen Jahren galt der Handel mit personenbezogenen Daten und Exploits noch als ein Gelegenheitsgeschäft unorganisierter Individuen. Mittlerweile hat sich Cyberkriminalität jedoch zu einem Wirtschaftszweig mit internationaler Struktur und ausdifferenzierten Service- und Ausbildungsmöglichkeiten entwickelt. Aus der einstigen Untergrund-Szene ist […]
Blogbeitrag anschauen

Echtzeit-Visualisierung von Computerinfektionen von Kaspersky
28. März 2014
Laut der Cyber Warfare Real Time Map von Kaspersky Lab führt Russland die Liste der Länder mit den meisten infizierten Computern an. Danach folgen Vietnam, die USA, Indien und Kasachstan. Deutschland belegt den achten Platz. Mittels einer Weltkarte visualisiert Kaspersky Lab in Echtzeit, welche Computerangriffe sich in welchen Ländern ereignen. Die Bezeichnung „Cyber Warfare Real Time Map“ ist […]
Blogbeitrag anschauen

Senioren ins Internet!
28. März 2014
Eine Initiative der Stiftung Digitale Chancen läuft weiter voll auf Erfolgskurs. Jetzt neue Bewerbungen möglich Von Jürgen Selonke Zur echten Erfolgsstory entwickelt sich eine Aktion der Stiftung Digitale Chancen, in deren Rahmen ältere Mitbürger durch die kostenlose Übergabe mobiler Endgeräte an das Internet herangeführt werden. Das Projekt, realisiert in Zusammenarbeit mit der E-Plus Gruppe, läuft […]
Blogbeitrag anschauen

Mit Express-Tempo in die digitale Welt
26. März 2014
98 Prozent der 14- bis 24-Jährigen sind online Schluss mit dem Mythos von Freundesinflation Neue Definition schützenswerter privater Daten Von Meike Demattio Welche Rolle spielt das Internet im Alltag junger Menschen? Wer ist im Internet ein „Freund“? Was bedeutet Vertrauen im Internet für sie? Die „DIVSI U25-Studie – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der […]
Blogbeitrag anschauen

Breites Medienecho zur DIVSI U25-Studie
7. März 2014
Die von uns am 06.03.2014 in Berlin vorgestellte U25-Studie: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt hat ein breites Echo in den Medien gefunden. Nachdem bereits die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Volksfreund, Der Tagesspiegel und Die Welt über unsere U25-Studie berichteten, folgte am Abend ein detaillierter Videobericht im ARD Nachtmagazin (ab Minute 14:14). Einen weiteren spannenden Videobeitrag lieferte ZDF […]
Blogbeitrag anschauen

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Identitätsdiebstahl
22. Januar 2014
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt bekannt: „Bei der Analyse von Botnetzen wurden 16 Millionen gestohlene digitale Identitäten entdeckt. Online-Kriminelle betreiben Botnetze, den Zusammenschluss unzähliger gekaperter Rechner von Privatanwendern, insbesondere auch mit dem Ziel des Identitätdiebstahls. Bei den digitalen Identitäten handelt es sich jeweils um E-Mail-Adresse und Passwort. E-Mail-Adresse und Passwort werden als Zugangsdaten […]
Blogbeitrag anschauen

Ist das Grundgesetz tauglich für die digitale Zeit?
30. Dezember 2013
Das Kieler Lorenz-von-Stein-Institut untersucht grundrechtliche Wirkungsdimensionen im digitalen Raum Von Dr. Sönke E. Schulz Die Enthüllungen von Edward Snowden und die Ausspäh-Aktivitäten der NSA, die offenbar die gesamte – und damit auch die deutsche – Internet-Kommunikation betreffen, prägen derzeit die öffentliche Debatte. Oftmals wird dabei eine Verbindung zu den Bestrebungen der Europäischen Union hergestellt, das […]
Blogbeitrag anschauen

Cyber-Mobbing – Wer schützt die Kinder?
27. Dezember 2013
Unwissenheit und Hilflosigkeit verschlimmern die Situation. Mädchen werden häufiger angegriffen als Jungen. Von Uwe Leest Karlsruhe – „Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Mit dieser Aussage hat Kanzlerin Angela Merkel während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama in diesem Jahr für großes Gelächter gesorgt. Noch mehr wie Hohn klingt diese Äußerung […]
Blogbeitrag anschauen

Nationaler IT-Gipfel verschoben – auf wann?
23. Dezember 2013
Verschieben war einfach, eine neue Terminierung dagegen scheint schwer. Unverändert ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kein Termin für den nationalen IT-Gipfel in Hamburg zu erfahren, der ursprünglich für den 10. Dezember geplant war. Bekannter Grund: „Der andauernde Prozess der Bildung einer neuen Bundesregierung“. Wann dieser Vorgang abgeschlossen sein wird, vermag bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe niemand zu sagen.
Blogbeitrag anschauen

Outsiders aus Neandertal und die heile, digitale Welt
19. Dezember 2013
Nach zwei Jahren wurden die Daten zu den DIVSI Internet-Milieus erneut erhoben, um den Stand der Entwicklung in Deutschland zu überprüfen Von Joanna Schmölz Hamburg – Mobile Endgeräte, einfach zu nutzende Apps und der unaufhaltsam fortschreitende Ausbau der Telekommunikationsnetze werden dafür sorgen, dass es den real existierenden „Offliner“ nicht mehr lange geben wird. So heißt […]
Blogbeitrag anschauen

Digitale Souveränität – Buzzword oder Aufbruch zu neuen Ufern? Wir brauchen eine schnelle und eindeutige politische Positionierung
16. Dezember 2013
Eine grundsätzliche Bemerkung vorweg: Vergessen Sie bitte alles, was ich in den letzten Jahren zum Thema Datensicherheit und die Rolle des Staates im Internet geschrieben oder gesagt habe. In den letzten Wochen ist ein digitaler Tsunami über uns hinweg gefegt, der das Fundament unserer virtuellen Welt erschüttert hat. Wir werden tatsächlich auf Schritt und Tritt überwacht, völlig aus dem Ruder gelaufene Schlapphüte befreundeter Nationen hören selbst das Mobiltelefon unserer Kanzlerin ab. Zwar sind meine Telefonate längst nicht so relevant, aber das Vertrauen in die Integrität unserer Infrastruktur ist dahin.
Blogbeitrag anschauen

Trotz Ausspäh-Aktionen: „Ein Rückzug aus dem Internet wäre fatal!“
13. Dezember 2013
Zweite Info-Veranstaltung zum DIVSI-Projekt. Diskussion in der Bucerius Law School Von Jürgen Selonke Hamburg – Das Interesse an der Thematik ist gewaltig, wie die dichtgedrängten Reihen in der Hamburger Bucerius Law School deutlich zeigten. Unter den interessierten Zuhörern auch DIVSI Schirmherr und Alt-Bundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog, begleitet von seiner Gattin Alexandra Freifrau von Berlichingen. […]
Blogbeitrag anschauen

Freiheit versus Regulierung im Internet
9. Dezember 2013
Die meisten Internet-Nutzer trauen es sich grundsätzlich zu, Risiken und Gefahren des Netzes einzuschätzen und möchten sich daher völlig frei und uneingeschränkt im Netz bewegen. So eine Erkenntnis aus unserer aktuellen Umfrage, die Allensbach für DIVSI bundesweit erhoben hat.
Blogbeitrag anschauen

Wir warten auf Ihren Beitrag!
2. Dezember 2013
Das DIVSI legt eine neue Schriftenreihe auf. Gesucht sind Themen zur Diskussion um Vertrauen und Sicherheit im Internet Von Dr. Göttrik Wewer Hamburg – Think Tanks wie das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) haben im Prinzip drei Instrumente, mit denen sie arbeiten können: Sie können Projekte betreiben, Studien vergeben oder Umfragen […]
Blogbeitrag anschauen

Braucht Deutschland einen digitalen Kodex?
4. November 2013
Von Dr. Dirk Graudenz Hamburg – In der ersten Phase des Projekts „Braucht Deutschland einen Digitalen Kodex?“ geht es darum, die grundsätzliche Frage zu beantworten, ob ein Digitaler Kodex ein geeignetes Instrument ist, um die Spielregeln im Netz im Spannungsfeld der Netzteilnehmer auszutarieren. Dabei stehen aktuell Fragen wie der sachliche Anwendungsbereich (also beispielsweise Kommunikationsplattformen, Online-Händler […]
Blogbeitrag anschauen

Cross-Device-Tracking: Das Ende jeder Privatsphäre?
25. Oktober 2013
Auf den Punkt gebracht: Die kreativen IT-Köpfe bei Google (und nicht nur dort) sollen an etwas feilen, was für zwei Dinge das Ende bedeuten könnte. Zum einen für Cookies, zum anderen für jegliche Privatsphäre im Netz. Fakt ist, dass diese neue Planung in den USA bereits heiß diskutiert wird. Der angesehenen New York Times ist […]
Blogbeitrag anschauen

Digitalisierung fördert das politische Interesse
29. August 2013
Ist das Internet ein wirksames Instrument im Kampf gegen fortschreitende „Politikverdrossenheit“? Hamburg – Wer sich im Internet zu Hause fühlt, zeigt an Politik ein höheres Interesse. So die Grunderkenntnis einer repräsentativen Umfrage, die das Heidelberger SINUS Institut jetzt im Auftrag von DIVSI durchgeführt hat. Jeder dritte der internetaffinen Digital Natives (31 %) gab dabei an, […]
Blogbeitrag anschauen

Netzneutralitäts-Diskussion muss raus aus der Eliten-Nische
29. August 2013
Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel hat im Rahmen der Präsentation der Studie „Der Diskurs zur Netzneutralität“ im Berliner BASE_camp kritisiert, dass die Diskussion um Netzneutralität nahezu ausschließlich von Eliten geführt wird. Gleichzeitig appellierte sie an die breite Masse der Internet-Nutzer, sich aktiv in diesen für die Gesellschaft so wichtigen Meinungsbildungsprozess einzubringen, denn „das Netz geht uns […]
Blogbeitrag anschauen

Jeder Zweite möchte online wählen
13. August 2013
Hamburg – Rund einen Monat vor der Bundestagswahl kann sich jeder zweite (50 Prozent) vorstellen, seine Stimme über das Internet abzugeben. Vier von zehn Befragten (43 Prozent) würden eine solche Online-Wahl sogar der Briefwahl vorziehen. Das ergab eine aktuelle Umfrage, die das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) in Zusammenarbeit mit dem […]
Blogbeitrag anschauen

PRISM und die Folgen: Sicherheitsgefühl im Internet verschlechtert
3. Juli 2013
Hamburg – Das Sicherheitsgefühl der Deutschen im Internet hat sich durch den Abhörskandal amerikanischer und britischer Sicherheitsbehörden grundsätzlich verschlechtert. Das belegt eine repräsentative Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI), die jetzt in Hamburg vorgestellt wurde. Danach gaben 39 % der Befragten an, sie fühlten sich bei ihren Aktivitäten unsicherer als […]
Blogbeitrag anschauen

Mehr Schutz oder mehr Freiheit?
19. Juni 2013
Die DIVSI Milieu-Studie zeigt: Insgesamt sehen knapp 60 Prozent der deutschen Bevölkerung die Verantwortung – betreffend Sicherheit und Datenschutz im Internet – primär bei der Wirtschaft und/oder beim Staat, der die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen soll. Dies sind Digital Outsiders, Digital Immigrants und eine Minderheit der Digital Natives. Zitat: „Wer sich nicht auskennt, fordert Schutz. Wer […]
Blogbeitrag anschauen

DIVSI in Baden-Württemberg: Matthias Kammer über Datenschutz und Sicherheit im Internet
13. Juni 2013
Am Mittwoch, den 12. Juni 2013, hielt DIVSI-Direktor Matthias Kammer einen Informationsvortrag für Unternehmer aus Baden-Württemberg. Im Rahmen der Veranstaltung „Vertrauen in Social Business/Media: Neue Dynamik für Ihre Geschäftsmodelle“ wurden die neuen Wirtschaftschancen erörtert, die sich mit der digitalen Vernetzung für Unternehmen ergeben. Matthias Kammer sprach über die besonderen Anforderungen an den Endnutzer, die aus […]
Blogbeitrag anschauen

Handlungsempfehlungen vorgelegt: Privatheit im Internet
10. Juni 2013
München – acatech, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, bezieht im Rahmen ihrer Schriftenreihe „acatech POSITION“ aktuell Stellung zur „Privatheit im Internet – Chancen wahrnehmen, Risiken einschätzen, Vertrauen gestalten“. Unter der Leitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Buchmann hat dabei eine Projektgruppe im Team mit zahlreichen Mitarbeitern eine Bestandsaufnahme erarbeitet, die in Handlungsempfehlungen zu den […]
Blogbeitrag anschauen

Darum brauchen wir sichere Identitäten
3. Juni 2013
Computer-Kriminalität gilt als moderne Geißel der Menschheit. Im Kampf dagegen geht die Bundesdruckerei einen eigenen Weg, um sichere Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Vernetztes Arbeiten in interdisziplinär angelegten Projekten ist angesagt. Von Ulrich Hamann Kleine mobile Alleskönner wie Smartphones, Tablet-PCs oder Netbooks erlauben es, immer und überall online zu sein. Sie verändern unsere Art […]
Blogbeitrag anschauen

Kein Ausnahmeverbrechen mehr
27. Mai 2013
Wie kann mit der neuen digitalen Bedrohung umgegangen werden? Experten schätzen das jährliche Schadenspotenzial auf bis zu 50 Milliarden Euro. Deshalb sollten wir endlich begreifen: IT-Sicherheit geht uns alle an. Von Arne Schönbohm „Sehr geehrter Kunde, aufgrund der hohen Malware Anschlag auf unsere Datenbank haben wir unsere SSL zur Hilfe verhindern unbefugten Zugriff auf Ihr […]
Blogbeitrag anschauen

Computerbrille sorgt für Ärger – Missbrauch der Technik?
20. Mai 2013
Hamburg – Was speichert die Google-Brille und wer hat Zugriff auf diese Daten? Wie Peter Schaar, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, mitteilte, bitten Datenschutzbeauftragte aus der ganzen Welt in einem gemeinsamen Brief an Google-Chef Larry Page um genauere Informationen zum Projekt Google Glass. Sie wollen darin wissen, welche Informationen Google über die Nutzer seiner Internet- […]
Blogbeitrag anschauen

Grundgesetz und Digitales Zeitalter: Passt das noch zusammen?
13. Mai 2013
Hamburg – Es ist eine hochbrisante Frage, die DIVSI in einem neuen Projekt untersuchen lässt: Ist unser Grundgesetz zur Bewältigung der Herausforderungen des digitalen Zeitalters geeignet? Das Kieler Lorenz-von-Stein-Institut für Verwaltungswissenschaften ist mit der Untersuchung beauftragt. Die Leitung haben Prof. Dr. Utz Schliesky sowie Dr. Sönke E. Schulz. Welche Auswirkungen die zunehmende Digitalisierung von Daten-, […]
Blogbeitrag anschauen

Sicherheit im Internet – was heißt das eigentlich?
6. Mai 2013
Täglich werden 30.000 Schadprogramme entwickelt. Es kommt darauf an, die Risiken vernünftig zu managen. Bei richtiger Vorsorge sind bis zu 90 Prozent der Standard-Angriffe vermeidbar. Von Dr. Göttrik Wewer Aus der Kriminologie wissen wir, dass man zwischen dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Menschen und der objektiven Sicherheitslage unterscheiden muss. Beide sind selten deckungsgleich. Dass die Lage […]
Blogbeitrag anschauen

Selbstregulierung im Datenschutz – Chancen, Grenzen, Herausforderungen
29. April 2013
Instrumente und Zielsetzungen müssen klar benannt werden. Auch Mindestanforderungen sind zu definieren, die eine glaubwürdige Umsetzung von Selbstverpflichtungen sicherstellen. Von Patrick von Braunmühl Nationale Gesetze zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz stoßen angesichts kurzer Innovationszyklen und immer neuer digitaler Produkte, die grenzüberschreitend genutzt werden, zunehmend an Grenzen. Instrumente der Selbstregulierung können den gesetzlichen Rahmen ergänzen und […]
Blogbeitrag anschauen

Selbstregulierung im Datenschutz – Chancen, Grenzen, Risiken
22. April 2013
Für die Anerkennung von Verhaltensregeln und den Umgang mit Ihnen sollte es klare gesetzliche Rahmenbedingungen geben. Auch in Bezug auf mögliche Rechtsfolgen. Von Peter Schaar Immer wieder wird – insbesondere seitens der Wirtschaft – das hohe Lied der Selbstregulierung gesungen. Besonders lautstark wird für Selbstregulierung geworben, wenn sich abzeichnet, dass der Gesetzgeber verbindliche Regeln setzen […]
Blogbeitrag anschauen

Allensbach-Umfrage für DIVSI: Freiheit versus Regulierung
15. April 2013
Hamburg – Das Themenumfeld zwischen Freiheit und Selbstbestimmung im Gegensatz zu Sicherheit und Regulierung im Internet wird eine aktuelle Allensbach-Umfrage ausloten, die DIVSI jetzt initiiert hat. Das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) ist für diesen Themenbereich auch als Herausgeber der seit 1997 jährlich erscheinenden „Allensbacher Computer- und Technik-Analyse“ (ACTA) ein idealer Partner. DIVSI-Direktor Matthias Kammer: […]
Blogbeitrag anschauen

Holistisches Sicherheitsmanagement braucht Transparenz
8. April 2013
Prävention, Behandlung, Rehabilitation: Warum es sich durchaus lohnt, vom Gesundheitssystem zu lernen, um Angriffe auf das Netz zu erschweren. Von Dr. Karsten Nohl Sicherheit wird heutzutage hauptsächlich als technische Abwehr von Angriffen verstanden. In der Konsequenz verursachen Angriffe, welche technische Barrieren durchdringen, oft hohen Schaden. Es lohnt sich, vom Gesundheitssystem zu lernen: Wir brauchen einen […]
Blogbeitrag anschauen

Braucht Deutschland einen digitalen Kodex?
1. April 2013
DIVSI stößt bundesweit eine neue Diskussion an. Großer Erfolg bei der ersten öffentlichen Info-Veranstaltung in München. Direktor Matthias Kammer erklärt im Interview ausführlich die Hintergründe. München – Vor einem hochkarätig besetzten Podium und zahlreichen interessierten Zuhörern eröffnete DIVSI Direktor Matthias Kammer (r.) im Münchener Oberangertheater die offizielle Auftaktveranstaltung für ein neues Projekt des Instituts. Geklärt werden […]
Blogbeitrag anschauen

Erklär-Videos für Digital Outsiders
4. März 2013
Wie „Starthilfe50.de“ Internet-Einsteigern das Leben erleichtert. Erkenntnisse aus vier Jahren Arbeit. Von Jürgen Selonke 27 Millionen der in Deutschland lebenden Menschen sind Digital Outsiders, nutzen das Internet also kaum oder gar nicht. Viele fühlen sich überfordert, sind ängstlich und verhalten sich deshalb sehr reserviert gegenüber den Möglichkeiten des Mediums. Das ist ein Ergebnis der DIVSI […]
Blogbeitrag anschauen

Was denken Entscheider über’s Internet? [Infografik]
28. Februar 2013
DIVSI hat heute seine „Entscheider-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet“ vorgestellt. Nach der DIVSI Milieu-Studie und der DIVSI Meinungsführer-Studie im letzten Jahr, konzentriert sich die aktuelle Studie auf diejenigen, die wesentliche Prozesse im Internet mitbestimmen: die Entscheider. 1.221 Entscheider aus Wirtschaft, Politik, Öffentlichem Dienst, Zivilgesellschaft, Medien sowie Wissenschaft und Forschung wurden dazu vom 10. September bis 2. November 2012 […]
Blogbeitrag anschauen

Vertrauen ist wie ein geldwerter Vorteil
11. Februar 2013
Der Glücksatlas für Deutschland zeigt: Der Nordwesten und Südosten liegen vorn Von Dr. Göttrik Wewer Warum beschäftigen sich Ökonomen mit Glück? Weil sie gemerkt haben, dass das Sozialprodukt eines Landes allein kein hinreichender Maßstab für das Wohlbefinden der Bevölkerung ist. Es gibt Länder, wo die Menschen relativ zufrieden sind, obwohl sie ziemlich arm sind, und […]
Blogbeitrag anschauen

Der Anfang ist gemacht: Was hat die „Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft“ gebracht?
4. Februar 2013
Von Harald Lemke Berlin – Im Mai 2010 hatte die Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft ihre Arbeit aufgenommen. Der Anfang gestaltete sich aus vielerlei Gründen schwierig. Die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, insbesondere von Sachverständigen und Abgeordneten, unterschiedliche Diskussionskulturen und unterschiedliche Herangehensweisen an komplexe Themen mussten zunächst in scheinbar endlosen Geschäftsordnungsdebatten auf einen Nenner gebracht werden. Selbst die […]
Blogbeitrag anschauen

Wer ist wo verortet?
21. Januar 2013
Internet-Milieus für Bevölkerung und Entscheider im Vergleich Von Dr. Dirk Graudenz Hamburg – Im Auftrag von DIVSI hat das SINUS-Institut in zwei quantitativen Studien Bevölkerung und Entscheider zu Vertrauen und Sicherheit im Internet befragt. In beiden Studien wurden Internet-Einstellungen und die jeweiligen Lebenswelten (SINUS-Milieus), in denen das SINUSInstitut unsere Gesellschaft regelmäßig abbildet, kombiniert. Die so entstandenen DIVSI Internet-Milieus ermöglichen einen pointierten […]
Blogbeitrag anschauen

Neue Werte-Ordnung für das digitale Zeitalter?
18. Januar 2013
Hamburg – DIVSI-Direktor Matthias Kammer referierte im Rahmen des „Informatischen Kolloquiums Wintersemester 2012/13“ in der Hamburger Universität. Sein Thema: „Vermessung der Netzwelt – Brauchen wir für das digitale Zeitalter eine neue Werte-Ordnung?“ Prof. Dr. Ingrid Schirmer, Fachbereichsleiterin Informatik der MIN-Fakultät (Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften) gab sich zuvor in ihrer Begrüßung optimistisch: „Ich sehe […]
Blogbeitrag anschauen

Pressekonferenz in Berlin: Große Resonanz auf die DIVSI Entscheider-Studie
7. Januar 2013
Berlin – Im Tagungszentrum der Bundespressekonferenz am Schiffbauerdamm in Berlin hat Direktor Matthias Kammer zusammen mit Dr. Silke Borgstedt (SINUS) die neue, bundesweit repräsentative „DIVSI Entscheider-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet“ vorgestellt. Er erinnerte eingangs an ein wesentliches Ergebnis aus der DIVSI Milieu-Studie von Anfang 2012: Demnach erwarten fast 75 Prozent der in Deutschland […]
Blogbeitrag anschauen

2. E-Government Hochschultag: „In vielfältiger Weise anregend und motivierend!“
5. Dezember 2012
Kamp-Lintfort – Bereits zum zweiten Mal hatte die Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal zum E-Government Hochschultag eingeladen. Dabei machten die Veranstalter deutlich: „Erfolgreiches E-Government stellt einen wesentlichen Baustein für die Verwaltungsmodernisierung dar und wird dazu beitragen, die Verwaltungen von heute auf zukünftige Herausforderungen auszurichten. E-Government unterstützt dabei die Verwaltung, Bürger und Wirtschaftsunternehmen und […]
Blogbeitrag anschauen

DIVSI Meinungsführer-Studie „Wer gestaltet das Internet?“
12. November 2012
DIVSI, das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet, hat seine Meinungsführer-Studie „Wer gestaltet das Internet?“ vorgestellt. In ausführlichen persönlichen Gesprächen wurden dazu führende Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Medien, Öffentlichem Dienst, Wissenschaft, Verbänden sowie weitere Vertreter der Zivilgesellschaft interviewt. Die qualitative Untersuchung entstand in Zusammenarbeit mit dem renommierten Heidelberger SINUS-Institut auf wissenschaftlicher Basis. Hier […]
Blogbeitrag anschauen

DIVSI Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet
10. Oktober 2012
Das Internet hat sich von einem rein technischen Angebot zum erweiterten Lebensraum der Menschen entwickelt. Entsprechend erweitern sich nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken und Unsicherheiten. Diese Studie zeigt auf, welche Meinungen und Vorstellungen es zu diesem Thema (bei Offlinern wie bei Onlinern) gibt, welche datenschutz- und sicherheitsrelevanten Einstellungs – und Verhaltenstypen existieren. […]
Blogbeitrag anschauen

Chancen und Risiken der Digitalisierung
3. September 2012
Zwingend notwendig: Ein einheitliches Datenschutz-Niveau in Europa Von Martina Koederitz Digitalisierung, Social Media und Cloud Computing ermöglichen heute völlig neue Geschäftsmodelle und sind wichtige, neue Erfolgsfaktoren. Die Kommunikation über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg hat neue Dimensionen erreicht. Viele Geschäftsmodelle werden durch digitale Geschäftsprozesse erst ermöglicht – das schließt die Erschließung komplett neuer Wertschöpfungsketten ein. Die dadurch neu entstehenden Formen der Kooperation […]
Blogbeitrag anschauen

Error 40, Nullen und riesengroße Chancen
23. Juli 2012
Und was meinen SIE dazu: 25 Zitate aus der DIVSI Meinungsführer-Studie Die DIVSI Meinungsführer-Studie vermittelt durch eine Vielzahl von Zitaten einen besonders präzisen Eindruck über die Gedankenwelt der interviewten Persönlichkeiten. Diese wörtlich übernommenen Aussagen – wie zugesagt immer ohne direkte Namensnennung – ziehen sich wie ein roter Faden durch die insgesamt sechs Kapitel. Natürlich sind dies sämtlich ganz subjektive Äußerungen, die […]
Blogbeitrag anschauen

Vier Thesen zur aktuellen Situation im Netz-Diskurs
16. Juli 2012
Von Dr. Silke Borgstedt Keiner ist mehr offline – Leben ohne Internet ist eine Illusion Alle Meinungsführer betonen, dass das Internet in immer mehr Lebensbereichen an Bedeutung gewinnt und sich Online- und Offline-Sphären dabei zunehmend durchdringen, so dass man diese beiden „Zustände“ immer weniger voneinander unterscheiden kann. In diesem Zusammenhang erscheint es durchaus plausibel, dass viele Akteure das Problem digitaler Gräben nicht als Herausforderung sehen, sondern als […]
Blogbeitrag anschauen

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz: Ohne Vertrauen geht es nicht
9. Juli 2012
Ausschnitte aus seiner Festrede im Rathaus „Auch in der digitalen Gesellschaft geht es nicht ohne Vertrauen als eine wesentliche Ressource des Zusammenlebens und des Wirtschaftens. Deswegen ist es wichtig, dass die digitale Wirtschaft sich um ihre Vertrauenswürdigkeit und um die Sicherheit ihrer Geschäftsmodelle kümmert. Hierfür müssen wir strukturelle Voraussetzungen schaffen. Die vier wichtigsten aus meiner Sicht: Erstens: Unternehmerische Verantwortung. […]
Blogbeitrag anschauen

Digital Outsiders unter der Lupe
4. Juni 2012
39 Prozent der Deutschen nutzen das Netz kaum oder gar nicht. Was sind das für Menschen? Von Dr. Silke Borgstedt Die DIVSI Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet kennzeichnet insgesamt sieben Milieus. Mit der Verortung der Typen entstehen ganzheitliche, empirisch fundierte Zielgruppen. Sie können nicht nur hinsichtlich ihrer Einstellung zu Vertrauen und Sicherheit im […]
Blogbeitrag anschauen

Laien, Souveräne, Hedonisten und Co.
30. Januar 2012
Eine Studie, sieben unterschiedliche Mileus. Welcher Typ Mensch verbirgt sich jeweils dahinter? Aufschluss bringt eine Kurz-Charakteristik. Von den „Internetfernen Verunsicherten“ bis zu den „Digital Souveränen“ kennzeichnet die Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet sieben unterschiedliche Milieus. Mit der Verortung der Typen entstehen ganzheitliche, empirisch fundierte Zielgruppen. Sie können nicht nur hinsichtlich ihrer Einstellung zu […]
Blogbeitrag anschauen

Milieu-Studie überrascht
23. Januar 2012
Bundesweit große Resonanz auf die Pressekonferenz in Berlin. Diskussion angestoßen, die der Thematik nur dienlich sein kann. DIVSI-Direktor Matthias Kammer hat bei einer Pressekonferenz in Berlin gemeinsam mit Dr. Silke Borgstedt (SINUS) die Ergebnisse der Bevölkerungsrepräsentativen „Milieu-Studie zu Vertrauen und Sicherheit im Internet“ vorgestellt. Die bundesweite Resonanz auf die vorgelegten Fakten quer durch alle unterschiedlichen […]
Blogbeitrag anschauen

Stiftungslehrstuhl für Cyber Trust
6. Dezember 2011
Das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet unterstützt die TU München. Ein wichtiger Beitrag auch für den Forschungsstandort Bayern. München – Das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) hat der TU München eine Professur für Cyber Trust gestiftet. Im Beisein von Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich, Staatssekretär Franz Josef Pschierer, dem […]
Blogbeitrag anschauen


































































































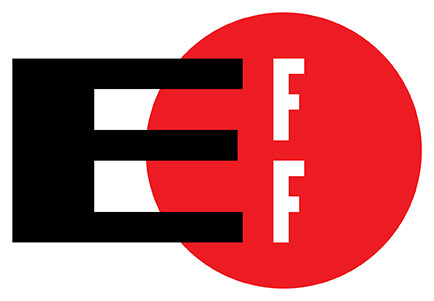













































![DIVSI U25-Studie: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der digitalen Welt – Ohne Internet keine gesellschaftliche Teilhabe? [Infografik]](https://www.divsi.de/wp-content/uploads/2014/05/DIVSI_teaser-ig3.jpg)





































































